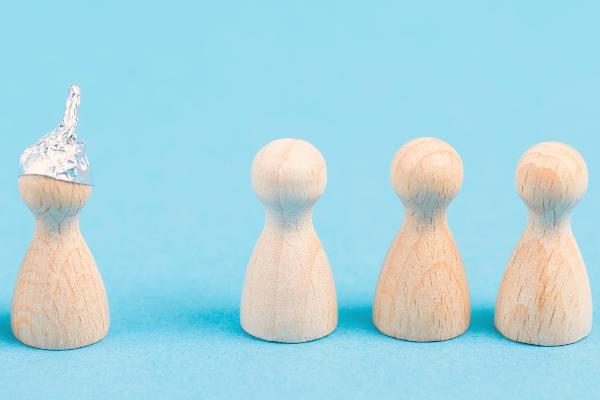Wissenschaft steht unter Druck. Das Vertrauen in Forschung und Fakten ist in Deutschland zwar immer noch groß. Aber die Zahl der Skeptiker ebenfalls. Laut Wissenschaftsbarometer zweifelt rund ein Drittel der Deutschen an der Wissenschaft selbst. Dabei gilt: Je niedriger der Bildungsstand, desto größer die Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Während der Coronapandemie wurde das besonders deutlich. Verschwörungserzählungen schossen ins Kraut, Impfgegner machten Stimmung gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. „Es war eine völlig neue Situation“, erinnert sich Professorin Birgit Neuhaus, Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik der Biologie an der LMU.
© picture alliance / Zoonar
Die größte Stärke wird zur Schwäche
Der gesellschaftliche Widerstand war groß. Ausgerechnet ihre größte Stärke – die Dynamik – wurde der Wissenschaft von ihren Kritikern als Schwäche ausgelegt. Wie konnten Masken anfangs überflüssig, später unverzichtbar sein? Warum trugen Schulkinder mal erheblich zum Infektionsgeschehen bei, mal nicht?
Der Wunsch nach einfachen Antworten war und ist nur allzu verständlich. Aber viele Prozesse sind schlicht zu komplex für monokausale Erklärungen. Gerade umstrittene Themen wie Evolution, Gentechnik oder Medizin verlangen eine differenzierte Sichtweise. Hinzu kommt: Studienergebnisse sind nicht in Stein gemeißelt. Forschende können und sollen einander durchaus widersprechen. Neue Erkenntnisse führen bisweilen zu einer veränderten Einschätzung bisheriger Ergebnisse. Kritik, Selbstkritik und Korrektur gehören daher ganz selbstverständlich zum Geschäft.
Vor Wissenschaftsfeindlichkeit schützt vor allem das Wissen darüber, wie Wissenschaft funktioniert. Wer nur aus Büchern lernt, kann ein solches Verständnis nicht entwickeln.
Birgit Neuhaus
Was ist wissenschaftlich? Was nicht?
Stark vereinfachte Meinungen allerdings haben oft sehr viel mehr Überzeugungskraft. Im Dauerfeuer der Sozialen Medien scheint es schier unmöglich, wissenschaftliche Annahmen von unwissenschaftlichen Behauptungen zu unterscheiden. Das gilt auch, aber nicht nur, für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen.
Birgit Neuhaus sieht hier die Universitäten in der Pflicht. „Sie haben beim Thema Wissenschaftsskepsis einen großen gesellschaftlichen Auftrag.“ Die Lehrerbildung müsse darauf reagieren, Lehramtsstudierende stärker in die wissenschaftliche Forschung einbinden. Denn, so Neuhaus' Überzeugung: „Vor Wissenschaftsfeindlichkeit schützt vor allem das Wissen darüber, wie Wissenschaft funktioniert. Wer nur aus Büchern lernt, kann ein solches Verständnis nicht entwickeln."
Der Lehrplan setzt auf Erkenntnisgewinnungskompetenz
Immerhin: In den Lehrplänen der Schulen ist die Fähigkeit, Informationen kritisch zu prüfen, im Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung inzwischen fest verankert. Sogar in die Abiturprüfung hat es das Thema geschafft. Am Lehrstuhl für Didaktik der Biologie lernen Lehramtsstudierende darum, ihren künftigen Unterricht so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler nachvollziehen können, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ihren Erkenntnissen gelangen.
In Rollenspielen trainieren die Studierenden, wissenschaftliche Argumente zu vertreten. Kommunikationsmethoden wie „Thinking Hands“ unterstützen sie dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse in verständliche Grafiken zu verwandeln. Aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Didaktik der Biologie, dem Helmholtz Zentrum München und der TU München ist überdies ein Unterrichtsfilm entstanden, der zeigt, wie naturwissenschaftliches Arbeiten funktioniert und woran man mangelhafte Studien erkennt.
Die Sensibilität ist also groß. Noch hängt es allerdings stark vom Engagement einzelner Lehrkräfte vor Ort ab, wie intensiv das Thema im Unterricht umgesetzt wird.
Junge Menschen müssen lernen, plakative Aussagen kritisch zu reflektieren.
Tobias Bjarsch
Ein sicherer Hafen in einer polarisierten Welt
Für Tobias Bjarsch ist „Erkenntnisgewinnungskompetenz“ ein großes Anliegen. Bjarsch ist Biologie- und Chemielehrer am Gymnasium in Starnberg, forscht und lehrt aber auch in der Biologiedidaktik der LMU. Seiner Ansicht nach sollte Schule „ein sicherer Hafen in einer polarisierenden Welt“ sein.
Auf seine Schülerinnen und Schüler, erzählt er, prasseln Unmengen vermeintlich wissenschaftlicher Informationen ein, viele davon „populistisch gefärbte Schwarz-Weiß-Darstellungen“. Die Unsicherheit, wie mit Quellen umzugehen ist, sei massiv. Sein Ziel: „Junge Menschen müssen lernen, plakative Aussagen kritisch zu reflektieren.“
Wasser, brandgefährlich
Manchmal scheut Bjarsch darum nicht davor zurück, seine Schülerinnen und Schüler auf die Probe zu stellen. Er führt einen bislang unbekannten Stoff namens Dihydrogenmonoxid in den Unterricht ein. Behauptet, es handle sich um etwas Gefährliches. Und freut sich, wenn seine Schülerinnen und Schüler ihr chemisches Wissen und ihre Kritikfähigkeit mobilisieren und erkennen: Der verteufelte Giftstoff ist schlicht – Wasser.
„Kritisch hinterfragen, was andere sagen, unaufgeregt prüfen, ob etwas plausibel ist, erkennen, wenn jemand was Falsches sagt, und merken, wie leicht man sich beeinflussen lässt: Darum geht es“, sagt Bjarsch. „Das sind die mündigen Schülerinnen und Schüler, die wir haben wollen.“